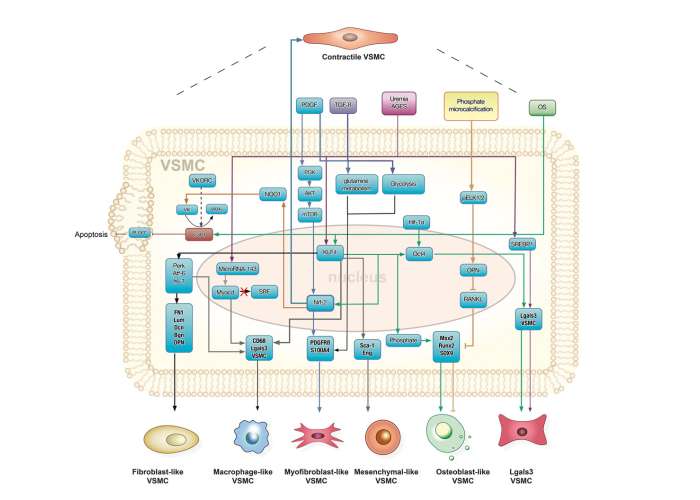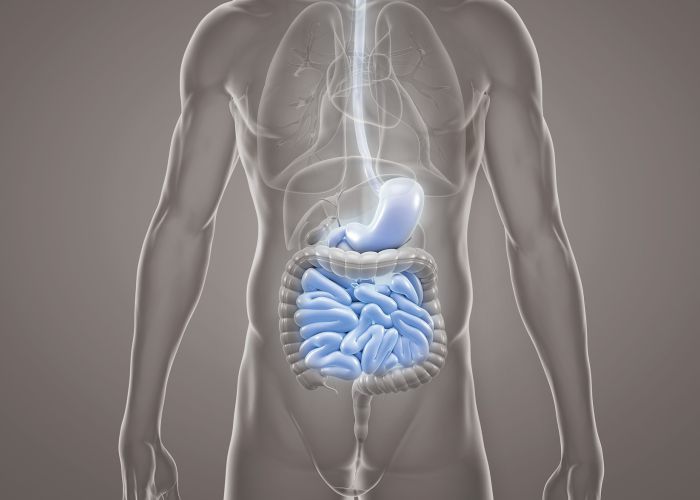Editorial des Ärzteblattes Sachsen-Anhalt

Prof. Gunther Gosch
(Foto: Peter Gercke)
Wer in diesen Wochen die Schlagzeilen verfolgt, gewinnt den Eindruck, das deutsche Gesundheitswesen sei ein Experimentierfeld für populistische Schnellschüsse geworden. Da fordert etwa Ralf Hermes, Chef der IKK Innovationskasse, ein Einfrieren der Honorare der ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte – also jener Berufsgruppe, die das Fundament unseres Versorgungssystems bildet. Gleichzeitig schwärmt er von der Wiederauflage der DDR-Polikliniken, als ließe sich ein über Jahrzehnte gewachsenes, patientennahes System einfach durch ein nostalgisches Modell ersetzen, das keinen einzigen zusätzlichen Arzt in das System bringt und dessen Produktivität keineswegs höher ist.
Solche Vorschläge sind keine Lösung, sondern Teil des Problems. Sie lenken ab von den wahren Ursachen der Misere: der strukturellen Unterfinanzierung der gesetzlichen Krankenkassen, ihrer Überlastung mit versicherungsfremden Aufgaben, den sich öffnenden Finanzierungslücken zwischen Leistungsempfängern und Beitragszahlern, der Bürokratie und einer stockenden Digitalisierung, die Ärztinnen und Ärzte in Praxis wie Klinik lähmen.
Wer in diesen Wochen die Schlagzeilen verfolgt, gewinnt den Eindruck, das deutsche Gesundheitswesen sei ein Experimentierfeld für populistische Schnellschüsse geworden. Da fordert etwa Ralf Hermes, Chef der IKK Innovationskasse, ein Einfrieren der Honorare der ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte – also jener Berufsgruppe, die das Fundament unseres Versorgungssystems bildet. Gleichzeitig schwärmt er von der Wiederauflage der DDR-Polikliniken, als ließe sich ein über Jahrzehnte gewachsenes, patientennahes System einfach durch ein nostalgisches Modell ersetzen, das keinen einzigen zusätzlichen Arzt in das System bringt und dessen Produktivität keineswegs höher ist.
Solche Vorschläge sind keine Lösung, sondern Teil des Problems. Sie lenken ab von den wahren Ursachen der Misere: der strukturellen Unterfinanzierung der gesetzlichen Krankenkassen, ihrer Überlastung mit versicherungsfremden Aufgaben, den sich öffnenden Finanzierungslücken zwischen Leistungsempfängern und Beitragszahlern, der Bürokratie und einer stockenden Digitalisierung, die Ärztinnen und Ärzte in Praxis wie Klinik lähmen.

Alle aktuellen Beiträge aus der Medizin und Mitteilungen der Ärztekammer Sachsen-Anhalt.

Das Pankreaskarzinom zählt zu den Tumorentitäten mit weiterhin steigender Inzidenz weltweit. Trotz erheblicher Fortschritte in Diagnostik und Therapie ist die Prognose nach wie vor schlecht. Im Jahr 2020 entfielen etwa 2,6 % aller neu diagnostizierten Krebserkrankungen und 4,7 % aller Krebstodesfälle auf das Pankreaskarzinom, womit es zu den sieben häufigsten tumorbedingten Todesursachen zählt (1). Die 5-Jahres-Überlebensrate beträgt insgesamt weiterhin lediglich rund 9 % (2). Eine wesentliche Herausforderung liegt in der späten Diagnosestellung. Unspezifische Frühsymptome, die frühe perineurale und venöse und arterielle Infiltration sowie die rasche Entwicklung metastatischer Herde führen dazu, dass die Mehrzahl der Tumoren erst in fortgeschrittenen Stadien entdeckt wird (3).
Repräsentative Kasuistik
Ein 15-jähriger Jugendlicher kommt alle drei Wochen auf die Tagesstation des Universitätsklinikums Halle (Saale), um eine Bluttransfusion zu erhalten. Er hat eine homozygote Beta-Thalassämie. Trotz täglicher Einnahme eines Eisenchelatbildners sind – ohne zusätzliche Maßnahmen – eine Eisenüberladung und, damit verbunden, Leberfunktionsstörungen, eine Herzinsuffizienz und endokrine Ausfälle im jungen bis mittleren Erwachsenenalter vorprogrammiert. Der Junge hat kein HLA-identisches, gesundes Geschwister, aber die Fremdspendersuche identifiziert eine/n an 10 von 10 HLA-Genorten passende/n Fremdspender/in.
Die Prävalenz der PAVK entspricht einer Volkskrankheit, wie in der Get-ABI-Studie gezeigt werden konnte (1). Die Häufigkeit lag in dieser Studie bei den > 65-Jährigen zwischen 11,5 % bei den Frauen und 20,9 % bei den Männern. Patienten mit einem ABI < 0,9 wurden als PAVK-Patienten klassifiziert, von denen viele noch asymptomatisch waren. Auch diese hatten jedoch ein signifikantes erhöhtes Risiko für schwerwiegende vaskuläre Ereignisse wie Herzinfarkte und Schlaganfälle (2). PAVK-Patienten sind häufig Patienten mit polyvaskulären Erkrankungen. Bei der Post-hoc-Analyse der CAPRIE-Studie hatten 11,8 % aller Patienten sowohl eine PAVK als auch eine KHK (3)(4).
In regelmäßiger Folge möchte der Ausschuss Qualitätssicherung der Ärztekammer Sachsen-Anhalt im Ärzteblatt Sachsen-Anhalt auf sicherheitsrelevante Ereignisse hinweisen, die dem interprofessionellen und interdisziplinären Lernen dienen.
Der berichtete Fall „Übernahme der Medikation bei unklarer Indikationslage“ wurde dem Netzwerk CIRS Berlin als regionalem Berichts- und Lernsystem für Berliner und Brandenburger Krankenhäuser zur Verfügung gestellt und dort vom Anwenderforum als Fall des Monats 10/2024 eingestuft.
Durch die vermehrte Anwendung leistungsstarker bildgebender Verfahren mit sukzessive gesteigerter Auflösung wie der Computertomographie (CT) und insbesondere der Magnetresonanztomographie (MRT) werden zystische Veränderungen in der Bauchspeicheldrüse zunehmend häufiger entdeckt. In einer deutschen prospektiven, bevölkerungsbasierten Kohortenstudie aus der Region Pommern wurden 1.077 Teilnehmer mittels MRT und Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie (MRCP) untersucht. Die Studie zeigte eine Prävalenz von Pankreaszysten von 49,1 % in der Bevölkerung mit einem starken Zusammenhang mit dem Alter der Probandinnen und Probanden.
Die Neonatologie hat sich in den letzten 40 Jahren rasant entwickelt. Nach der Einführung von natürlichen Surfactant-Präparaten in die Therapie des neonatalen Atemnotsyndroms wurden zunehmend schonende Beatmungsstrategien in die klinische Routine implementiert. Es reifte die Erkenntnis, dass auch sehr kleine Frühgeborene nur mit non-invasiver Atemunterstützung gut den Schritt ins Leben finden können.